Haben Sie auch gehört, dass über 60 % der Münchner dafür gestimmt haben, dass die Stadt sich für die olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben? Dann schon mal eins vorweg: Das stimmt nicht. Die Aussage wurde so überspitzt, dass sie falsch ist. Die Wahrheit würde auch weniger spektakulär klingen: 27,82 % der Münchner haben sich dafür ausgesprochen. Und diese Zahl ist schon wohlwollend, man möchte ja nicht zu kleinlich sein. Warum verbreiten aber alle Medien die Zahl von über 60 %? Weil das das Ergebnis der Abstimmung war.
Okay, um es klarzustellen: Bei der Wahl selbst entfielen 66,4 % der abgegebenen Stimmen auf Zustimmung, soweit ist das richtig. Nur entspricht die Anzahl der abgegebenen Stimmen nicht annähernd der Zahl der Wahlberechtigten. Das Zauberwort heißt „Wahlbeteiligung“, und die lag bei 42 %. Noch nicht einmal die Hälfte der Münchner, die ihre Stimme hätten abgeben dürfen, haben das getan. Und hier kommen wir zurück zu der Einschränkung, die ich im ersten Absatz gemacht habe: ich schrieb, die Zahl von 27,82 % sei wohlwollend. Das liegt daran, dass die Anzahl der Wahlberechtigten nicht der Anzahl der Einwohner von München entspricht. Nimmt man die Anzahl der Einwohner von München (laut Bevölkerungsstatistik der Stadt München am 31.08.2025: 1.604.771 Personen1) als Basis für die Berechnung, so haben nur 19,02 % „aller Münchner“ für die Olympiabewerbung gestimmt. Aber wie bereits gesagt, da darf man nicht zu pingelig werden. Bleiben wir bei den Wahlberechtigten – und da sieht es nicht gut aus. Nicht einmal die Hälfte hat überhaupt abgestimmt. Und das wurde auch noch gefeiert als „Erfolg der Demokratie“. Nur weil die Beteiligung höher war als zuvor. 42 % ist eine schlechte Wahlbeteiligung. Manche Menschen sind offenbar sehr leicht zufriedenzustellen.
Aber wo will ich mit der Argumentation eigentlich hin? Ganz einfach: Mir wurde ein Artikel in die Timeline gespült, der zwar aus dem Jahr 2024 stammt (die Älteren werden sich erinnern, damals hatten wir noch keinen Bundeskanzler, der gerne mal ausländisch wahrgenommene Menschen als „Problem im Stadtbild“ oder Armutsbetroffene als „Faulpelze“ beschimpfte), aber schon einmal die Problematiken bei der Berichterstattung über Olympiabewerbungen aufgespießt hat: „Wenn es um Olympiabewerbungen geht, werden Journalisten zu ahnungslosen PR-Leuten“ Der Artikel auf Übermedien ist von Jens Weinreich, der detailliert beschreibt, wie Journalisten einfach PR-Sprech übernehmen, anstatt zu versuchen, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken.

Das passt gut zu der Erfahrung, die ich heute auf dem Weg nach Hause machte, als das Radio im Auto lief und ich ein Déjà Vue (oder besser gesagt, ein „Déjà Entendu Parler“2) hatte. Es ist schon einige Jahre her, da habe ich in einem Beitrag das Format „Top Thema“ von SWR 3 dafür kritisiert, dass es in den Berichten kaum in die Tiefe geht und von den Journalisten oberflächliche Behauptungen aufgestellt werden, ohne dass man dafür Belege liefert. Und etwas ähnliches hörte ich nun auch wieder. Passend zum Übermedien-Artikel von Jens Weinreich kamen im SWR 3 Top Thema mit der Überschrift „Startschuss für einen weiten Weg“ hauptsächlich die Argumente der Befürworter vor. Klar, die Zustimmung hat gewonnen, nichtsdestotrotz hätte das Thema eine kritische Einordnung verdient gehabt. Zum Beispiel das, was ich zum Eingang dieses Artikels gebracht habe, dass nämlich nicht „zwei Drittel der Münchner“ für die Olympiabewerbung gestimmt haben. Oder dass man etwas differenzierter über die Gegenargumente spricht. Diese wurden kurz in einem Satz abgehandelt: „Die Gegner der aktuellen Bewerbung für Sommerspiele wie die ‚Nö-Lympia‘-Kampagne fürchten unkontrollierbare Kosten, die finanziellen Knebel des Internationalen Olympischen Komitees und eine Verschärfung der in München ohnehin großen Probleme auf dem Mietmarkt oder beim ÖPNV.“ Das war’s. Der Bericht spricht lieber über die „neue Energie“, die durch Deutschland wehen könnte und die vielen tollen Dinge und Modernisierungen, die man durch Olympia haben könnte, zum Beispiel bei den Sportstätten oder der Infrastruktur. Entschuldigung, aber braucht es dazu olympische Spiele? Kann man die Infrastruktur denn nicht modernisieren, weil Modernisierungsbedarf besteht? Offenbar nicht, dazu braucht es das Milliardenspektakels eines privaten Verbands, der mit dem ursprünglichen olympischen Geist so viel zu tun hat, wie ein chinesisches Elektroauto mit einem Esel, auf dem man im Jahre 50 vor der Zeitenwende durch die Wüste geritten ist. Irgendwie ist das Prinzip (Fortbewegung) noch da, ansonsten gibt es aber nichts Gemeinsames.
Uli Hoeneß hat über die Olympiabewerbung gesagt: „Wir brauchen Aufbruch in diesem Land, wir brauchen eine Perspektive.“ Na, da wird der Bürgergeldempfänger und die Bürgergeldempfängerin, denen man das Bürgergeld wegnimmt, weil er oder sie aus guten Gründen (oder wegen Versagen des Jobcenters) einen Termin nicht wahrnimmt, aber froh sein! Hey, Du weißt nicht, wie Du Dein Essen bezahlen kannst? Egal, in München ist Olympia! Rentner, lasst das Pfandflaschensammeln sein! Pack die Badehose ein, der Aufbruch ist da! Kann man ein Kommerz-Sportereignis eigentlich noch mehr überhöhen?
Als Positivbeispiele werden dann vergangene olympische Spiele herangezogen, der Favorit ist Paris 2024. So will es München auch machen. Wie Paris. Oder London. Keine guten Beispiele. Schon vor den Spielen in Paris machten Journalisten auf drastische Missstände aufmerksam:
Eine Mauer des Schweigens bezüglich Vorwürfen sexuellen Missbrauchs im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 in Paris; finanzielle Unregelmäßigkeiten; Verstöße gegen das französische Sportgesetz; Versäumnisse bei der Umsetzung von Gesetzesreformen; Falschaussagen gegenüber Ermittlern und vieles mehr.
The Inquisitor: „On the road to Paris 2024: ‚omerta at all levels‘, a ‚rape culture‘ and ’systemic dysfunctions‘ in sport„
Und auch zu Hoeneß‘ markigen Worten von „Aufbruch“ und „Perspektive“ gibt es ein Gegenbeispiel. Bei den olympischen Spielen von London 2012 ließ Tony Blair Ähnliches verlauten, nur sein Zauberwort war „Vermächtnis“. Die Spiele würden ein „Vermächtnis“ hinterlassen in der britischen Gesellschaft. Zehn Jahre später ist das Resümee vernichtend:
Was das Thema „Vermächtnis“ betrifft, so war es unwahrscheinlich, dass die Olympischen Spiele 2012 in London viel davon hinterlassen würden, schon allein deshalb, weil das Wort selbst Teil der Inszenierung ist: unterhaltsam, überzeugend, aber weitgehend vergänglich.
The Guardian: „London 2012, 10 years on: wrestling with a sporting legacy built on false assumptions„
Was aus meiner Sicht noch dazu kommt: München ist hochverschuldet (laut dem Schuldenbericht waren es Ende 2024 5,3 Milliarden Euro). Wie geht das zusammen, gerade in diesen Zeiten? Ausgaben werden gekürzt, wo es geht, aber kaum kommt Olympia, ist alles anders? Tatsächlich wurden für die Werbekampagne im Rahmen der Abstimmung schon Millionenbeträge ausgegeben. Aber naja, wie lautet das Motto der Spiele? „Dabeisein ist alles.“ Das stimmt natürlich nicht so wirklich, denn sonst gäbe es keine Goldmedaillen und auch keine Gewinner.
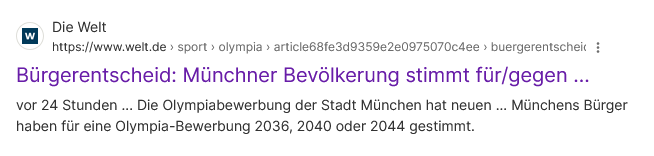
Die größten Gewinner der Olympischen Spiele sind das IOC, die TOP-Sponsoren und die Medienkonzerne. Diese Akteure profitieren von den hohen Einnahmen aus Sponsoring, Medienrechten und Werbung. Die Austragungsstädte und Länder tragen hingegen oft hohe Kosten und Risiken, die zu langfristigen Schulden führen können. Beispiele für finanzielle Verluste sind die Olympischen Spiele in Montreal 1976, die fast 30 Jahre brauchten, um die Schulden zu tilgen, und die Spiele in Athen 2004, deren Infrastruktur heute verwaist ist und zur griechischen Schuldenkrise beitrug. Auch Rio 2016 hinterließ verlassene Infrastruktur und hohe Schulden3. Tokio 2020 (2021) kostete rund 15 Milliarden US-Dollar, wobei die Einnahmen von 6,7 Milliarden US-Dollar deutlich darunter lagen.
Die Olympischen Spiele haben gemischte wirtschaftliche Langzeitfolgen. Einerseits bringen sie Investitionen in Infrastruktur, Tourismus und Arbeitsplätze. Andererseits führen die hohen Kosten oft zu langfristigen Schulden und „weißen Elefanten“, also ungenutzten Sportstätten, die hohe Unterhaltskosten verursachen. Die Spiele in Peking 2008 kosteten über 40 Milliarden US-Dollar, wobei die Infrastrukturkosten den Großteil ausmachten.4 Die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile sind oft geringer als erwartet, da die Spiele andere wirtschaftliche Aktivitäten verdrängen und die Kosten die Einnahmen überwiegen.
Die Finanzierung der Olympischen Spiele ist oft von mangelnder Transparenz geprägt. Die genauen Verträge und Geldflüsse zwischen dem IOC, den Sponsoren und den Austragungsstädten sind nicht immer öffentlich einsehbar, was zu Spekulationen und Misstrauen führt. NGOs wie „Play the Game“ und Wissenschaftler wie Andrew Zimbalist kritisieren die Intransparenz und die übermäßige Profitorientierung des IOC.5
Ethische Fragen betreffen auch die Menschenrechtsverletzungen bei Bauprojekten, die Verschwendung öffentlicher Gelder und die langfristigen Schulden, die die Austragungsstädte tragen müssen. Die Olympischen Spiele sind oft mit Gentrifizierung und der Verdrängung von lokalen Bewohnern verbunden, was die soziale Ungleichheit verstärkt.6
Die Olympischen Spiele haben auch erhebliche ökologische Kosten. Der Bau von Infrastruktur und Sportstätten führt zu Umweltzerstörung, und die Veranstaltung selbst verursacht hohe CO2-Emissionen. Die Nachhaltigkeit der Spiele ist ein zunehmend wichtiges Thema, das jedoch oft zugunsten von wirtschaftlichen Interessen vernachlässigt wird.7
Und nun? Der Rückblick fühlt sich für mich merkwürdig an. Von meiner Mutter wurde mir erzählt, dass ich seinerzeit bei den ersten und bislang einzigen olympischen Spielen in München 1972 bei den Schwimmwettkämpfen von Mark Spitz mitgefiebert habe. Ich war damals zwei Jahre alt. Ja, wirklich. Aus den Erzählungen meiner Mutter habe ich abgeleitet, dass ich so aufgeregt war, weil sie aufgeregt war und Spitz angefeuert hat. Und danach war Olympia diese besondere Veranstaltung. In YPS gab es zu den Olympiaden von Moskau und Lake Placid eine Sammelserie mit allen Sportarten und ihren Regeln, sehr schön aufbereitet, wie ein Lexikon. Ich hatte die Serie vollständig. Zu jeder Olympiade gab es von Francisco Ibañez ein Sonder-Comicalbum von „Clever & Smart„, die zum Austragungsort der Spiele reisten und ihre unmöglichen Abenteuer erlebten. Die „Dschungelolympiade“ war lange Zeit einer meiner Lieblingsfilme. Irgendwann ließ es nach. Ich kann es nicht an einem bestimmten Punkt festmachen, aber der Umstand, dass immer mehr über die unfreundliche Seite der Spiele bekannt wurde, hat sicherlich mit reingespielt. Mittlerweile laufen mir die Spiele mehr oder weniger zufällig „über den Weg“, ich schaue sich nicht mehr aktiv. Entkommen kann man ihnen ja nicht.
Der SWR-Beitrag heißt nicht umsonst „Startschuss für einen weiten Weg“. Es wird noch Jahre dauern, bis das IOC eine Entscheidung trifft. Bis dahin muss sich München nicht nur gegen deutsche Mitbewerber (Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr-Region) durchsetzen, sondern letztlich auch gegen internationale Konkurrenz. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Mal sehen, was noch kommt.
- Quelle: Stadt München ↩︎
- Französisch: „schon mal gehört“ ↩︎
- Quelle: IREFEUROPE.org ↩︎
- Quelle: M Accelerator ↩︎
- Quelle: Jens Weinreich ↩︎
- Quelle: Journal of Economic Surveys auf Researchgate ↩︎
- Quelle: ebd. ↩︎
